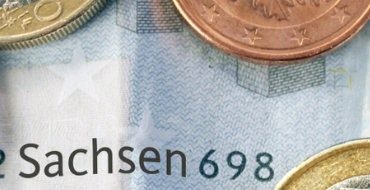Aus der Mitte des LACDJ Sachsen wurden eine Debatte über den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Schulbildung jedes Kindes initiiert. Unter Einbeziehung der Meinung von Bürgern, Eltern und Lehrern entstand folgendes Positionspapier:
Standpunkte zum verfassungsrechtlichen Anspruch auf Schulbildung in Coronazeiten (Stand: 31.05.2021)
1. Ausgangslage/Bestandsaufnahme
Die COVID-19-Pandemie hat zu massiven Einschnitten in den Schulunterricht geführt. Seit über einem Jahr findet an sächsischen Schulen kein durchgehender Präsenzunterricht mehr statt. In Abhängigkeit von Inzidenzwerten sind seit März 2020 Homeschooling und Wechselunterricht an der Tagesordnung. Die damit einhergehenden Auswirkungen für schulpflichtige Kindern und deren Eltern sind dramatisch.
Inhalt, Ausgestaltung und Qualität des Unterrichts hängen noch mehr als sonst von der jeweiligen Schule und der verantwortlichen Lehrerin oder dem verantwortlichen Lehrer ab. An Grundschulen wird größtenteils nur in den Hauptfächern unterrichtet, während Fächer wie Kunst, Musik, Schulgarten, Sport oder Werken kaum gelehrt werden. An weiterführenden Schulen liegt es am jeweiligen Fachlehrer, überhaupt Onlineunterricht anzubieten oder den Kindern in häuslicher Lernzeit Gelegenheit zu geben, sich Wissen im Selbststudium anzueignen. Zwar steht mit LernSax eine digitale Plattform für Distanzunterricht zur Verfügung. Da jedoch nicht alle Haushalte über Computer, Drucker und leistungsfähige Internetverbindungen verfügen, ist ein Teil der Kinder und Jugendlichen vom digitalen Unterricht ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass aufgrund von technischen Problemen oder teilweise fehlender Bereitschaft von Lehrkräften zur Nutzung der Plattform digitaler Unterricht nicht regelmäßig, nicht in allen Schulklassen und nicht fächerübergreifend stattfindet. Kinder erhalten im Distanzunterricht nur sporadisch Noten auf erbrachte Leistungen.
Mit monatelangem Fernunterricht, Fehlen des Schulalltags, mangelnden sozialen Kontakten zu Mitschülerinnen und Mitschülern und fast vollständigem Verbringen des Tages in den eigenen vier Wänden gehen verstärkt psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen einher. Kindeswohlgefährdungen haben deutlich zugenommen; beispielhaft verdreifachten sich im Landkreis Meißen die Fallzahlen.
Die Situation benachteiligt besonders Kinder aus bildungsfernen Schichten, deren Bildungschancen selbst in Normalzeiten deutlich hinter denen anderer Kinder zurückbleiben. Art. 29 der Sächsischen Verfassung spricht vom gleichen Zugang auf Bildung. Dies scheint durch den sehr uneinheitlichen digitalen Unterricht der einzelnen Schulen gefährdet. In den Art. 101 und 102 SächsVerf gewährleistet das Land das Recht auf Schulbildung. Auch dies könnte bei der derzeitigen nur teilweisen Beschulung gefährdet sein.
2. Rechtliche Einordnung
Das Angebot und die Durchführung von Schulunterricht stehen nicht im Belieben der Politik, sondern folgen einem vorgegebenen rechtlichen Rahmen.
Das Recht auf Bildung stellt ein universelles Menschenrecht dar (Art. 26 Allgemeine Menschenrechtserklärung, Art. 13 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 28 Kinderrechtskonvention). Bildung ist in der Verfassung des Freistaates Sachsen als ein Staatsziel formuliert (Art. 7 Abs. 1 SächsVerf). Art. 9 Abs. 1 SächsVerf erkennt das Recht eines jeden Kindes auf eine gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung an. Gemäß Art. 29 Abs. 2 SächsVerf haben alle Bürger das Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Art. 101 ff. SächsVerf enthalten Regelungen zum Bildungswesen; Art. 102 Abs. 1 SächsVerf gewährleistet das Recht auf Schulbildung und bestimmt eine allgemeine Schulpflicht. Der Freistaat Sachsen steht in der Pflicht, die notwendigen finanziellen, sachlichen und organisatorischen Mittel bereitzustellen, damit jeder das Recht auf Schulbildung wahrnehmen kann. Dabei basiert die Vorstellung des Verfassungsgebers auf der Durchführung von Präsenzunterricht.
Der staatliche Bildungsauftrag und das Recht des Einzelnen auf Bildung gelten nicht absolut und sind nicht abwägungsresistent. Sie müssen sich mit anderen konfligierenden grundrechtlich geschützten Rechtsgütern messen; zwischen ihnen ist ein schonender Ausgleich am Maßstab der praktischen Konkordanz vorzunehmen. Dies gilt im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie insbesondere für die staatliche Schutzpflicht für das Leben und die Gesundheit (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 14 Abs. 1 SächsVerf).
Es bedarf deshalb in Pandemiezeiten einer sorgfältigen Abwägung zwischen Belangen des Gesundheitsschutzes auf der einen und Belangen der Bildung auf der anderen Seite.
Bei Inzidenzwerten von über 100 unterliegt der Schulbetrieb den bundesgesetzlichen Einschränkungen des § 28b Abs. 3 IfSG. Bei darunterliegenden Inzidenzwerten kann der Landesgesetzgeber gemäß § 28a Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 33 Nr. 3 IfSG i.V.m. der jeweiligen Coronaschutzverordnung die Schließung von Schulen oder die Erteilung von Auflagen für die Fortführung des Betriebs als Schutzmaßnahme zur Verhinderung der Verbreitung von COVD-19 vorsehen.
Gesetzliche Regelungen zur konkreten Ausgestaltung von Homeschooling und Wechselunterricht sind nicht vorhanden.
3. Ausblick
Ein klares Konzept zur Ausgestaltung von Homeschooling im Freistaat Sachsen muss künftig Schwerpunkt für Schulen, Lehrkräfte und Eltern werden. Der Improvisation müssen künftig klare Strukturen folgen und der verfassungsrechtliche Anspruch allen Kindern gewährt werden.
Die Politik darf die skizzierten Probleme nicht aussitzen und darauf hoffen, dass sich die COVID-19-Pandemie bald erledigt haben wird. Es gilt, aus dem bisherigen Pandemiegeschehen zu lernen und daraus für Gegenwart und Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die aktuelle Pandemie ist noch nicht beendet und niemand kann vorhersagen, wann die nächste auf uns zukommt. Das kann erst in hundert Jahren der Fall sein, aber auch schon in Monaten.
Der LACDJ spricht sich deshalb dafür aus, eine gesetzliche Regelung für den Schulunterricht in Pandemiezeiten zu schaffen und somit das Thema dem für Gesetzgebungsverfahren üblichen Diskurs zu unterwerfen. Im Hinblick auf die beschriebene hohe grundrechtliche Relevanz gebieten die Wesentlichkeitsdoktrin eine gesetzliche Ausgestaltung der an die Regelungen des Infektionsschutzrechts anknüpfenden genaueren Voraussetzungen von Homeschooling und Wechselunterricht im Sächsischen Schulgesetz. Dies betrifft – bei Inzidenzen von weniger als 100 (vgl. § 28b Abs. 3 Satz 1 Hs. 2 IfSG) – auch die Teilnahme am Präsenzunterricht in Krisenzeiten, sofern dieser von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht wird (Testpflicht, Impfnachweis, Nachweis einer überstandenen Infektion). Nicht geimpfte Kinder dürfen nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden.
Die detaillierte Ausgestaltung von Homeschooling und Wechselunterricht kann dem Verordnungsgeber überlassen bleiben. Lehrpläne sind an die Besonderheiten dieser Unterrichtsmodelle anzupassen. Das zuständige Fachressort hat dafür Sorge zu tragen, dass Schuldirektorinnen und -direktoren sowie Lehrkräfte umfassend geschult werden, um den besonderen Anforderungen an den Unterricht in Krisenzeiten zu entsprechen.
Rechtspolitisches Positionspapier (Stand: 05.09.2016)
Wir bekennen uns im Freistaat Sachsen zum Gewaltmonopol des Staates. Nur der starke Staat kann eine Ordnung in Demokratie, Sicherheit und Freiheit garantieren. Der Staat muss geltende Gesetze konsequent umsetzen. Dies kann der Freistaat Sachsen nur leisten, wenn alle Bereiche personelle und sächlich ausreichend ausgestattet sind.
1. Personal in der Justiz und im Justizvollzug
Die Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz kann nur dann sichergestellt werden, wenn die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, ausreichend Personal und Ausstattung bereitgestellt werden. Der demokratische Rechtsstaat hat sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der internationale Terrorismus wird auch vor den deutschen Landesgrenzen nicht Halt machen. Hinzu kommt die zunehmende Verrohung bei Sportereignissen und Demonstrationen. Schließlich ist der immense Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen.
Diese Probleme bedingen große Anstrengungen im Bereich der zuständigen Verwaltung, insbesondere bei der Polizei, den Ausländerbehörden und dem Bundesamt für die Migration und Flüchtlinge. Diese Anstrengungen müssen sich auch im Personalbestand der Justiz fortsetzen, deshalb muss der Freistaat Sachsen sein Personal in der Justiz erhöhen und dazu auch neue Stellen schaffen. Eine Bewältigung der Probleme kann ohne rechtstaatliche Einbußen nur gelingen, wenn die Justiz ihre Aufgaben erfüllen kann.
Erste Ansätze sind im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Zuweisung weiterer Richter und Geschäftsstellenkräfte bereits erfolgt. Dies muss sich auch in den anderen Gerichtsbarkeiten, insbesondere auch bei den Staatsanwaltschaften fortsetzen.
Auch die Altersstruktur der Justiz ist zu bedenken. Ein hoher Anteil der Richter gehört zu der Altersgruppe der 50 bis 60jährigen. Auch bei den Staatsanwälten findet sich eine vergleichbare Altersstruktur. Dazu benötigen wir ein Personalentwicklungskonzept, um qualifiziertes Personal auch nach der Pensionierung vieler Richter und Staatsanwälte in ausreichender Anzahl zu haben. Dieses Konzept sollte nicht bei der Frage der Einstellung und Termine stehen bleiben, sondern auch Grundsätze für die weitere Entwicklung (Leitungsaufgaben, Beförderungen) bieten.
Auch die Ausstattung der Justiz mit IT-Technik muss ausreichend, zweckmäßig und funktionsfähig sein.
Die ausgeführten Thesen gelten besonders für den Bereich des Justizvollzugs. Auch hier sind die Belastungen durch eine unausgewogene Altersstruktur in den Blick zu nehmen und vorausschauende Maßnahmen zu ergreifen.
Der Justizvollzug leistet seinen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der inneren Sicherheit im Freistaat Sachsen.
Der Justizvollzug braucht eine Initiative zur Verbesserung der Altersstruktur. Neben neuen Ausbildungsstellen muss die Aus- und Weiterbildung gestärkt werden. Dabei muss die Zahl der Vollzugsbediensteten, die ihr Arbeitsleben im durchgängigen Schichtdienst absolvieren, erhöht werden. Vergleichbares gilt für die Fachdienste, die ihren Beitrag zur Resozialisierung leisten. Der Schwerpunkt muss die Gewährleistung des Behandlungsvollzuges mit Gefangenen und die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den Haftanstalten bilden.
Der Justizvollzug im Freistaat Sachsen hat die Aufgabe, neben der Strafverbüßung alles für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft Notwendige zu tun. Die Resozialisierung steht dabei im Vordergrund. Das Ziel ist ein Leben ohne kriminelle Handlungen nach der Haftentlassung. Von den Gefangenen wird erwartet, sich selbst von den begangenen Taten zu distanzieren. Während der Strafverbüßung sind ausreichend Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsangebote und weitere Maßnahme, die einen durch Arbeit begleiteten Tagesablauf gewährleisten, bereitzustellen. Im Mittelpunkt muss das Erlernen von sozialem Zusammenleben stehen. Sozialkompetenz und Werte wie Gerechtigkeit, Teilhabe und Solidarität sind anzustrebende Ziele. Arbeit, Bildung und das Erlernen sozialer Kompetenzen sind die besten Grundlagen für die Vorbereitung des Lebens in der Freiheit.
Die Vielzahl der Aufgaben des Strafvollzuges kann nur mit einer ausreichenden Personalausstattung bewältigt werden. Es reicht nicht aus mit einem Mindestbestand bloß zu „verwalten“.
2. Verbesserungen des Rechtssystems
Verbesserungen des existierenden Rechtssystems sind aber nicht nur eine Frage des Personals und der Ausstattung, sondern auch der inhaltlichen Überlegungen.
Der Schwerpunkt des LACDJ liegt derzeit bei folgenden Themen
7 Punkte für eine moderne Bürgerbeteiligung
Das Recht auf Beteiligung des Volkes an der Gestaltung ist ein tragender Grundsatz einer demokratischen Gesellschaft. Bürger können sich vielfältig engagieren und einbringen, dies geschieht in Gemeinderäten, als sachverständiger Bürger, in Bürgerinitiativen oder Vereinen. In Kreistagen oder Parlamenten spielen dabei Parteien eine große Rolle. Im Bereich der Rechtsprechung ist die Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter (eine Errungenschaft der bürgerlich-demokratischen Revolution 1848/49) ein tragendes Element des deutschen Rechtssystems.
Der LACDJ setzt sich dafür ein, dass die Bürgerbeteiligung verstärkt wird:
- Wirksame Bürgerbeteiligung ist eine Grundlage dafür, dass richtige Entscheidungen getroffen werden können.
- Bürgerbeteiligung bedeutet Information und Mitsprache des Bürgers bei Vorhaben in Gemeinden, Landkreisen und bei Vorhaben des Freistaates Sachsen. Information, Mitsprache und Transparenz sind wichtige Grundlagen der Demokratie. Die Bürger können so politische Prozesse, auch im Gesetzgebungsverfahren, mitgestalten.
- Die klassischen Verwaltungsverfahren zur Planfeststellung oder Erteilung einer Genehmigung bilden weiterhin die Grundlage für ein rechtsstaatliches Vorgehen so-wie die gerichtliche Kontrolle. Neue und zusätzliche Formen der Beteiligung (z.B. Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen, Diskussionen zu Gesetzesvorhaben bis hin zu elektronischen Bürgerbeteiligungsportalen) sollen auch neben dem Verwaltungsverfahren offen stehen können.
- Die Bürgerbeteiligung ist auch bei langfristigen Verfahren durch Information sicherzustellen.
- Beteiligungsverfahren sind offen für alle Interessierten als Mitglieder einer lebendigen demokratischen Gesellschaft. Diese große Offenheit ist möglich, da das klassische Entscheidungsverfahren in der alleinigen Verantwortung der staatlichen Verwaltung bestehen bleibt.
- Eine gute Bürgerbeteiligung ist auf die Unterstützung der der Berichterstattung in den Medien angewiesen. Ausgewogene Berichte tragen zum Erfolg des Beteiligungsverfahrens maßgeblich bei.
- Moderne Bürgerbeteiligung ist angewiesen auf die Bereitschaft der Bürger sich einzubringen.
3. Datensicherheit / moderner Staat
Für den LACDJ ist die Rechts- und Netzpolitik Teil einer modernen Gesellschaftspolitik. Der LACDJ fordert einen wirksamen Schutz und eine durchgreifende Achtung des Grundrechts auf Informationelle Selbstbestimmung.
Das Informationelle Selbstbestimmungsrecht verleiht dem Einzelnen die Befugnis, grundsätzlich selbst zu bestimmen, wann und in welchem Umfange er persönliche Lebenssachverhalte preisgeben möchte. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das durch Art. 2 i.v.m. Artikel 1 des Grundgesetzes geschützt wird. es genießt daher Verfassungsrang und ist wesentliche Ausprägung der Menschenwürde und der allgemeinen Handlungsfreiheit. Die Sächsische Verfassung greift diese Forderung in Artikel 33 auf.
Bereits heute schreibt das sächsische E-Governmentgesetz (von 2014) vor, dass die Behörden des Freistaates für den Verkehr mit dem Bürger den Empfang verschlüsselter Nachrichten anbieten müssen. Bislang ist dies eher die Ausnahme als die Regel. Zur Absicherung gegen Manipulation ist für alle Behörden des Freistaates eine durchgängige Sicherheitsstrategie notwendig. Teil der Sicherheitsstrategie kann auch ein Verschlüsselungssystem sein. Dazu wird auch ein Kommunikationsnetz benötigt, das Daten sicher überträgt.
Trotz diverser „Skandale“ um „gehackte“ Daten erleben wir, dass private Daten freiwillig preisgegeben und von Internetanbietern, Suchmaschinen, Providern, Payback-Anbietern etc. gesammelt werden. Sie machen sich das menschliche Streben nach Konsum, Unterhaltung, Spiel, Information und Kommunikation zunutze, indem sie ihre Dienste nur dem anbieten, der seine Daten preisgibt. Es werden Informationen über den Einzelnen abgelegt, deren Verwendung für uns im Dunkeln bleibt.
Den Bürgern sind verstärkt Informationen und konkrete Handreichungen zu geben, wie sie den Schutz ihrer Daten durch Mittel wie sparsamer Veröffentlichung von Daten und durch Einsatz von Verschlüsselungstechniken sicherstellen kann. Mit diesen Maßnahmen ist schon in den Schulen zu beginnen.
Cybersicherheit, Datenschutz und vertrauenswürdige IT sind Grundlagen für einen sicheren digitalen Datenverkehr.
Der Schutz der Grund- und Bürgerrechte in einer digitalen Gesellschaft ist ein Thema christlich-demokratischer Politik, der Einzelnen muss nicht nur aufgeklärt, sondern auch geschützt werden. Ein effektiver Schutz der Grundrechte in der Informationsgesellschaft bedeutet Datenschutz auf europäischer und internationaler Ebene weiter zu entwickeln.
4. Verbraucherschutz– Verbraucherrechte stärken
Der Verbraucher steht einem nahezu unüberschaubaren Angebot von Waren und Dienstleistungen gegenüber. So wie der LACDJ vom mündigen Bürger erwartet, dass er über die Kompetenz verfügt, sich (rechts-) sicher am Markt zu bewegen, so fordert er von Produzenten und vom Handel das Verhalten eines „ehrbarer Kaufmanns“.
Diese haben dafür einstehen, dass die von ihnen in erstellten und in Umlauf gebrachte Waren und Dienstleistungen sicher sind und über die zugesicherten Eigenschaften verfügen. Irreführende Werbung und Zusagen ins Blaue hinein sind stärker zu sanktionieren. Der wirtschaftlichen Macht von Industrie und Handel muss in Fällen eines Fehlverhaltens eine gestärkte Verbraucherposition gegenüber gestellt werden.
Die bereits bestehende Möglichkeit der Individualklage (oder Klagen von eingetragenen Verbraucherschutzverbänden) ist durch die Möglichkeiten von Sammelklagen zu stärken.
Darüber hinaus müssen zudem abschreckende Sanktionen vorsehen werden, die Produzenten und Handel von Täuschungen und Manipulationen abhalten, wie z. B. Preis- oder Gebietsabsprachen.
So stellt der bekanntgewordene Skandal um die Manipulationen von Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen nicht nur ein betrügerisches Verhalten gegenüber den Käufern dar. Durch erhöhte Schadstoffwerte wurde bzw. wird auch die Gesundheit von Menschen wie auch die Umwelt gefährdet. Entsprechendes Handeln muss durch spürbare, auch am Gewinn des Unternehmens orientierte Schadensersatzzahlungen/Strafzahlungen sanktioniert werden. Ein Unternehmen mit Milliardengewinnen wird sich von niedrigen Bußgeldern niemals abschrecken lassen. Fehlverhalten muss unabhängig von einem Verschulden von Unternehmensleitungen spürbare finanzielle Konsequenzen haben.
Unlauteres Gewinnstreben ist unserer Rechtsordnung fremd und darf sich nicht lohnen. Soziale Marktwirtschaft erfordert zwingend Korrektive für die schwächeren Marktteilnehmer.
5. Mediation – Juristischer Paradigmenwechsel
Bereits seit 2012 gilt das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren außergerichtlicher Konfliktbeilegung. Das Kernstück des Gesetzes bildet das Mediationsgesetz, das erstmals die Rahmenbedingungen für das Verfahren und den Mediator gesetzlich regelt. 2016 wurde mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und einer Verordnung über die Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten nachgelegt.
Der LACDJ macht sich stark für konsensuale Konfliktlösungsvarianten und ihre öffentliche Wahrnehmung. Konflikte möglichst frühzeitig zu befrieden verlangt von der Anwaltschaft Kenntnisse über Konfliktlösungsmodelle, die sorgfältig mit den Rechtsuchenden gegeneinander abzuwägen sind. Eine dabei kompetent am Recht und am Interesse des Rechtsuchenden orientierte Dienstleistung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche außergerichtliche Streitbeilegung.
Die Vorteile eines Mediationsverfahrens sind gleichzeitig die Grundsätze, die dieses Verfahren prägen: Eigenverantwortung, Vertraulichkeit, Freiwilligkeit, Neutralität, Informiertheit. Die Nachhaltigkeit der von den Beteiligten selbständig gefundenen Lösung ermöglicht weitere Beziehungen, sei es privat oder geschäftlich.
Ein Gerichtsverfahren dagegen ist immer fremdbestimmt, in der Regel öffentlich, auf Beklagtenseite unfreiwillig, zwar neutral, jedoch von prozessualen Taktiken beherrscht, das am Ende einen Sieger und einen Verlierer festlegt. Für viele Rechtsuchende wird ein Gerichtsverfahren regelmäßig nicht nur wegen dem ungewissen Ausgang als sehr belastend empfunden.
Trotz der Neufassung der Zivilprozessordnung, wonach bei Klageerhebung angegeben werden soll, ob dieser ein Versuch eines außergerichtlichen Konfliktbeilegungsverfahrens vorausgegangen ist, lässt sich bisher gerade in der Anwaltschaft - wohl aus Gebühreninteresse - wenig Akzeptanz für die Mediation finden.
Hingegen hat sich die Justiz in Sachsen durch qualifizierte Richter bereits gut aufgestellt und dadurch Akzeptanz für die Mediation bei Rechtsuchenden geschaffen:
Ein entscheidungsbefugter Richter kann das Verfahren nach Zustimmung der Beteiligten an den sog. Güterichter verweisen, der dann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation anwenden kann.
Der LACDJ steht dafür, dass eine außergerichtliche Streitbeilegung orientiert an den Interessen der Beteiligten durch Anwaltsmediatoren einen wichtigen Beitrag für den Rechtsfrieden schaffen kann und muss. Auch die Rolle des Güterichters soll noch mehr in der öffentlichen Wahrnehmung in den Fokus rücken.
"Recht sichert Freiheit" - Grundsatzpapier des LACDJ Sachsen (Stand: Herbst 2013)
1. Zugang der Bürger zum Recht gewährleisten
Das Grundgesetz (Art. 19 Abs. 4 GG) und die Sächsische Verfassung (Art. 38 SächsVerf) garantieren dem Bürger den Zugang zur Justiz. Er hat einen Anspruch darauf, sich an die Gerichte wenden zu können und darüber hinaus effektiven Rechtsschutz zu erhalten.
Dieser Anspruch ist nicht voraussetzungslos. So können dem Bürger die Kosten des Gerichtsverfahrens auferlegt werden, sofern diese nicht unzumutbar hoch werden. Dafür ist derzeit nichts ersichtlich.
Der Rechtsschutz muss effektiv sein. Daran kann man anhand der Verfahrenslaufzeiten zweifeln. Wenn gerichtliche Verfahren über ein Jahr dauern und selbst in Eilverfahren Monate in Anspruch nehmen, ist das wenig effektiv. Zudem werden viele Verfahren durch unstreitige Erledigungen beendet. Das wird in vielen Fällen eine gute Lösung darstellen, wenn die Parteien/Beteiligten sich gütlich einigen. Wenn eine Einigung nur unter Erledigungsdruck angestrebt wird und nur erfolgt, weil man sonst unabsehbar warten muss, ist das kein positiver Ausgang des Verfahrens. Der Erledigungsdruck bei Gericht darf nicht dazu führen, dass die Rechtsanwälte ihre Aufgabe als Organ der Rechtspflege nicht mehr nachkommen können.
Die Gründe für lange Verfahrenslaufzeiten sind vielfältig. Die Besetzung der Gerichte erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Personalbedarfserhebung (Pebb§y). Grob gesagt wird damit ausgerechnet, wie viele Richter, Rechtspfleger und weiteres Personal notwendig ist, um die eingehenden Verfahren zu bewältigen. Bei der personellen Ausstattung der sächsischen Justiz wird indes hier nicht eine 100% Besetzung angestrebt, sondern Unterbesetzungen werden in Kauf genommen. Das führt nicht nur zu Defiziten bei der Bearbeitung der eingehenden Verfahren, sondern auch zu einem Bestand an nicht erledigten Verfahren. Diese Verfahren werden dann bei der Zuweisung von Personal nicht mehr berücksichtigt, weil nur der aktuelle Eingang einbezogen wird. Wenn also an einem Gericht viele Altverfahren anhängig sind, ist die nach Pebb§y vorgenommene Personalzuweisung nicht adäquat.
Wir stehen weiter für die Justiz in der Fläche, damit der Bürger wohnortnah Zugang hat.
2. Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz sichern
Die Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz wird zunächst gesichert durch eine gute sachliche Ausstattung und Unterbringung. Hier sind keine grundsätzlichen Defizite erkennbar.
Die Personalausstattung entspricht nicht immer den tatsächlichen Bedürfnissen (s. o. Ziff. 1). Der Verzicht darauf, an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eine 100% Besetzung (Pebb§y) anzustreben, kann dazu führen, dass personell unterbesetzte Einrichtungen Personal an andere Behörden abgeben sollen, nur weil diese noch schlechter ausgestattet sind. Das spricht für sich.
Die Herausforderung der nächsten Jahre wird die heutige Altersstruktur der Richterschaft sein. In fast allen Gerichtszweigen ist die Mehrheit der Richter über 50 Jahre alt.
Das Gewinnen von qualifiziertem Personal muss frühzeitig und vorausschauend begonnen werden.
Ganz wesentlich für einen funktionierenden Rechtsstaat ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auf die zügige Abwicklung von Gerichtsverfahren vertrauen können. Am Rechtsstaat darf aber nicht gespart werden.
3. Strafverfolgung als Teil der Inneren Sicherheit gewährleisten
Polizei ist für jede und jeden wieder sichtbar Freund und Helfer. Innere Sicherheit ist auch ein Gefühl der Bevölkerung, obwohl die »Polizeilichen Kriminalstatistik« in Sachsen ein Sinken der Kriminalität ausweist, wird dies so nicht wahrgenommen. Dies Gefühl hängt
stark mit Vertrauen in Staat und gesellschaftliche Einrichtungen zusammen Es ist wichtig, Straftaten schnell zu verfolgen und Gerichte bald urteilen zu lassen. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene dürfen nicht das Gefühl bekommen, die Tat sei sehr lange her, bevor das Gerichtsverfahren einsetzt.
Nur ein starker Staat kann eine Ordnung, die Freiheit und persönliche Sicherheit gibt, schützen und aufrechterhalten. Deshalb sind Freiheit des Bürgers und Autorität des Staates keine Gegensätze, sie bedingen einander. Die Wahrung des inneren Friedens ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage menschlichen Zusammenlebens in jeder Gemeinschaft und unabdingbare Voraussetzung für Freiheit und Entfaltung der Bürger. Nur der Staat, der sich gegen die Bedrohung des inneren Friedens entschlossen zur Wehr setzt und Gesetzesbrecher konsequent zur Verantwortung zieht, wird vom vertrauen seiner Bürger getragen.
Wir bekennen uns zum staatlichen Gewaltmonopol. Es gehört zu den Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates. Das Gewaltmonopol des Staates bedeutet nicht staatliche Allmacht, sondern schützt gerade die Schwächeren in der Gesellschaft und ist Voraussetzung für die Rechtssicherheit des Bürgers.
Der Staat muss die geltenden Gesetze konsequent durchsetzen. Die demokratisch legitimierte und rechtlich verfasste Staatsgewalt und die sie ausübenden staatliche Organe dürfen keine rechtsfreien Räume dulden.
Organisierte Formen der Kriminalität müssen mit aller Konsequenz verfolgt werden. Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität, neue Formen der Kriminalität im Internet müssen durch die Stärkung der Strafverfolgungsbehörden bekämpft werden. Dabei müssen wir uns zur Bekämpfung der Kriminalität im internationalen Finanzverkehr diesen neuen Herausforderungen stellen. Zur Bekämpfung von Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Rauschgifthandel und illegalem Glücksspiel bedarf es der weiteren Verbesserung der Strafverfolgung.
Wir unterstützen Polizei und Justiz im Kampf gegen das Verbrechen nachhaltig. Sie müssen über die zur Bewältigung ihrer schwierigen Aufgaben notwendigen Rechtsgrundlagen sowie über eine angemessene, aufgabengerechte personelle und sachliche Ausstattung verfügen können.
Wirksame Kriminalitätsbekämpfung gibt es nicht zum Nulltarif. Auch in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen müssen die notwendigen Mittel für die Verbrechensbekämpfung bereitgestellt werden. Das muss Priorität haben.
4. Recht sichert wirtschaftliche Entwicklung
Der Rechtsstaat bringt Rechtssicherheit. Die Verlässlichkeit der Einhaltung von Regeln ist eine Voraussetzung dafür, dass Individuen und Firmen planen und wirtschaften können. Der Verzicht auf Rechtssicherheit und Einschränkungen der Garantie, Rechtsschutz suchen zu können (s. o.), entwertet Planungsentscheidungen oder macht sie gar unmöglich. Nicht umsonst ist Deutschland ein wirtschaftlich herausragendes Land. Der Rechtsstaat, also funktionierende Justiz und zuverlässige Verwaltung, garantieren fairen Wettbewerb für Handwerk und mittelständische Unternehmen.
5. Opferschutz verbessern
Der Schutz und die Rechte des Opfers von Straftaten und Opferangehörige müssen im Strafverfahren größeres Gewicht haben. Opfer dürfen mit den Folgen der Tat nicht allein gelassen werden. Sie brauchen schnell und unbürokratisch Hilfe. Der strafrechtliche Deal und die Kronzeugenregelungen müssen die Ausnahme bleiben. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen so ausgestattet sein, dass eine effektive Strafverfolgung (auch im Sinne der Opfer) möglich ist.
Menschen, die Opfer betreuen, begleiten oder unterstützen sowie Opferschutzvereinigungen müssen unterstützt und in ihren Ehrenämtern bestärkt werden.
6. Europäische Rechtsetzung nicht verkomplizieren
Das Subsidiaritätsprinzip ist eine Grundlage der Europäischen Union. Daran muss sie sich messen lassen. Das europäische Recht nimmt immer mehr Einfluss auf unsere Rechtswirklichkeit. Das liegt nicht nur an den vielen Regelungen in klassischen Bereichen des Europarechts, sondern auch an einer Ausweitung auf Bereiche, in denen es noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien, dass hier Europarecht gelten solle (etwa Beamtenrecht). Hinzu kommt die expansive Rechtsprechung des EuGH, der im Zweifel für die Anwendbarkeit von europäischen Regelungen entscheidet.
Die europäischen Regelungen sind zum Teil äußerst komplex (Umweltrecht, Naturschutz). Das ist oft der Schwierigkeit der Materie geschuldet. Für die Rechtsanwender kommt hinzu, dass viele nationale Besonderheiten durch den Vereinheitlichungswillen der Institutionen der EU nach und nach fallen.
Es darf nicht Ziel sein, nationale Besonderheiten in allen Bereichen zu nivellieren. Unterschiedliche Regelungen sind nicht per se ein Hindernis, sondern entsprechen oft den Bedürfnissen der Menschen und Regionen.